|
Bei seefelder.de suchen: |
|
Die Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen im insolvenzrechtlichen Sinne
Wird eine Kapitalgesellschaft oder eine GmbH & Co. KG zahlungsunfähig oder überschuldet , so haben die Mitglieder des Vertretungsorgans ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber innerhalb von drei Wochen seit der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Insolvenzantrag zu stellen (§ 15a Abs. 1 InsO). Bei der Drei-Wochen-Frist handelt es sich um eine Höchstfrist. Diese darf nur ausgenutzt werden, wenn berechtigte Chancen für die Sanierung des Unternehmens bestehen. Ist dies nicht der Fall, so muss sofort Insolvenzantrag gestellt werden.
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 InsO). Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).
Abzugrenzen ist die Zahlungsunfähigkeit von der Zahlungsstockung. Eine Zahlungsstockung liegt vor, wenn der Schuldner nur zur Zeit nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, aber konkrete Aussichten auf eine baldige Beendigung des Zahlungsengpasses erkennbar sind. Nach dem BGH vom 24.05.2005 (DB 2005, 1787) ist eine bloße Zahlungsstockung anzunehmen,
- wenn der Zeitraum nicht überschritten wird, den eine kreditwürdige Person benötigt, um sich die benötigten Mittel zu leihen. Dafür sind drei Wochen erforderlich, aber auch ausreichend.
- Beträgt eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke des Schuldners weniger als 10 % seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit auszugehen, es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird.
- Beträgt die Liquiditätslücke des Schuldners 10 % oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist.
Weitere Urteile des BGH zum insolvenzrechtlichen Begriff der Zahlungsunfähigkeit:
BGH, Beschluss vom 13.06.2006, IX ZB 238/05Der Leitsatz der Entscheidung lautet:
a) Befindet sich der Schuldner mit fälligen Gesamtsozialversicherungsbeiträgen von mehr als sechs Monaten im Rückstand, hat
der Gläubiger den Insolenzgrund der Zahlungsunfähigkeit in der Regel glaubhaft gemacht.
b) Nach Antragstellung eingehende Teilzahlungen stellen die Zulässigkeit des Gläubigerantrags unter dem Gesichtspunkt des
Insolvenzgrunds nur in Frage, wenn mit ihnen die geschuldeten Zahlungen an die Gesamtheit der Gläubiger im Allgemeinen
wieder aufgenommen worden sind.
Der Entscheidung liegt der Sachverhalt zugrunde, dass auf Gläubigerantrag einer Krankenkasse das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, nachdem das Unternehmen mit der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten im Verzug war. In dem Rechtsstreit ging es um die Frage, ob die Gläubigerin den Insolvenzgrund glaubhaft gemacht hat. Der BGH führte aus:
Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit ist im Insolvenzrecht (§§ 17, 129 ff InsO, § 64 GmbHG) einheitlich zu verstehen Danach liegt (wie der BGH unter Bezugnahme auf sein oben zitiertes Urteil vom 24.05.2005 ausgeführt wird) keine Zahlungsstockung, sondern Zahlungsunfähigkeit im Rechtssinne vor, wenn die innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke des Schuldners 10 vom Hundert überschreitet, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalles zuzumuten ist Die Zahlungsunfähigkeit kann, wie § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO verdeutlicht, nicht nur im Wege der Ermittlung der Unterdeckung für einen bestimmten Zeitraum, sondern auch mit Hilfe von Indiztatsachen festgestellt werden (BGH, Urt. v. 9. Januar 2003 - IX ZR 175/02). Nach der Rechtsprechung des Senats stellt bei Anwendung dieser Methode die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen ein starkes Indiz dar, welches für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit spricht, weil diese Forderungen in der Regel wegen der drohenden Strafbarkeit gemäß § 266a StGB bis zuletzt bedient werden (BGH, Urt. v. 10. Juli 2003 - IX ZR 89/02). Die strafbewehrte Sanktion lässt das Vorliegen einer bloßen Zahlungsunwilligkeit als unwahrscheinlich erscheinen, insbesondere bei einer monatelangen Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Fehlen gegenläufige Indizien, die etwa in einem Bestreiten der nichterfüllten Forderungen des Sozialversicherungsträgers liegen können, reicht dieses starke Indiz für sich genommen aus, um den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit jedenfalls als wahrscheinlich erscheinen.
BGH, Urteil vom 12.10.2006, IX ZR 228/03
In dieser Entscheidung geht es um eine Anfechtung des Insolvenzverwalters gegen den Wirtchaftsprüfer der Schuldnerin im Hinblick auf Zahlungen der Schuldnerin an den Wirtschaftsprüfer und damit um die Frage, ob zum Zeitpunkt der Zahlung Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis der Gläubigerin von der Zahlungsunfähigkeit bestand.
Der BGH führte aus, dass zunächst gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO zu prüfen ist, ob die Schuldnerin im Zeitpunkt des Geldempfangs durch den Wirtschaftsprüfer ihre Zahlungen eingestellt hatte. Die in dieser Vorschrift formulierte Vermutung gilt auch im Rahmen des § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO (BGH, Urt. v. 9. Januar 2003 - IX ZR 175/02). Liegt Zahlungseinstellung vor, begründet dies nach dem BGH eine gesetzliche Vermutung für die Zahlungsunfähigkeit, die vom Prozessgegner zu widerlegen wäre. Zahlungseinstellung ist dasjenige äußere Verhalten des Schuldners, in dem sich typischerweise eine Zahlungsunfähigkeit ausdrückt. Es muss sich also mindestens für die beteiligten Verkehrskreise der berechtigte Eindruck aufdrängen, dass der Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (BGH, Urt. v. 9. Januar 2003 - IX ZR 175/02).Eigene Erklärungen des Schuldners, eine fällige Verbindlichkeit nicht begleichen zu können, deuten auf eine Zahlungseinstellung hin, auch wenn sie mit einer Stundungsbitte versehen sind (BGH, Urt. v. 4. Oktober 2001 - IX ZR 81/99). Die Sache wurde an das Berufungsgericht zurückgewiesen, weil sie noch nicht ausreichend aufgeklärt war. Der BGH gab hierzu folgende Hinweise:
- Allerdings wurden die Anträge auf Stundung noch vor Fälligkeit gestellt. Wurde ihnen rechtzeitig stattgegeben, fehlte es an der Fälligkeit der Forderungen. Hierzu und zu der Frage, ob es sich um einen erheblichen Teil der Verbindlichkeiten der Schuldnerin handelte, hat das Berufungsgericht jedoch keine Feststellungen getroffen.
- Das Berufungsgericht hat auch dem Umstand keine Bedeutung beigemessen, dass nach Behauptung des Klägers die Schuldnerin zum 30. April 2000 die Löhne der gewerblichen Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß gezahlt hat. Dies sei unerheblich, weil sie gleichzeitig die Gehälter der Angestellten weitergezahlt habe. Das Berufungsgericht hat offenbar angenommen, einzelne beträchtliche Zahlungen schlössen die Zahlungseinstellung aus. Dies ist unzutreffend. Die tatsächliche Nichtzahlung eines erheblichen Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Zahlungseinstellung aus (BGH, Urt. v. 8. Oktober 1998 - IX ZR 337/97; v. 13. April 2000 - IX ZR 144/99, v. 4. Oktober 2001 - IX ZR 81/99). Dies gilt auch dann, wenn tatsächlich noch geleistete Zahlungen beträchtlich sind, aber im Verhältnis zu den fälligen Gesamtschulden nicht den wesentlichen Teil ausmachen (BGH, Urt. v. 25. Januar 2001 - IX ZR 6/00; v. 17. Mai 2001 - IX ZR 188/98; v. 4. Oktober 2001, aaO; v. 19. Dezember 2002 - IX ZR 377/99; v. 10. Juli 2003 - IX ZR 89/02).
- Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob unter dem Gesichtspunkt der bis zuletzt nicht beglichenen Verbindlichkeiten der Schuldnerin eine Zahlungseinstellung im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO vorliegt. Nach den Behauptungen des Klägers hatte die Schuldnerin am 31. März 2000 fällige Verbindlichkeiten in Höhe von 4,92 Mio. DM aus Lieferungen und Leistungen offen stehen, die bis zuletzt unbedient blieben und deshalb zur Tabelle angemeldet wurden. Zum 7. April 2000 soll der Betrag dieser Forderungen auf 5,13 Mio. DM, zum 20. April 2000 auf 5,45 Mio. DM, zum 28. April 2000 auf 5,65 Mio. DM und zum 4. Mai 2000 auf 5,78 Mio. DM angestiegen sein. Danach wäre die Schuldnerin bei Einlösung des ersten Schecks bereits seit einer Frist von knapp drei Wochen ab dem 31. März 2000 nicht in der Lage gewesen, fällige Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 4,92 Mio. DM zu begleichen. Sie konnte sie auch in der Folgezeit nicht tilgen. Sofern es sich hierbei nicht nur um einen unerheblichen Teil der Verbindlichkeiten der Schuldnerin gehandelt hat, lag deshalb bereits seit 31. März 2000 Zahlungseinstellung vor. Eine einmal eingetretene Zahlungseinstellung hätte danach nur dadurch wieder beseitigt werden können, dass die Schuldnerin ihre Zahlungen allgemein wieder aufgenommen hätte. Das hätte derjenige zu beweisen, der sich hierauf beruft.
- Das Berufungsurteil hat eine Zahlungseinstellung vor allem auch deshalb abgelehnt hat, weil die Nichtbegleichung der Verbindlichkeiten nicht nach außen in Erscheinung getreten sei. Auch dies ist indessen unzutreffend. Durch die Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeiträge, der Löhne und der sonst fälligen Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen nach Fälligkeit ist für die beteiligten Verkehrskreise hinreichend erkennbar geworden, dass die Nichtzahlung auf einem objektiven Mangel an Geldmitteln beruhte. Gerade Sozialversicherungsbeiträge und Löhne werden typischerweise nur dann nicht bei Fälligkeit bezahlt, wenn die erforderlichen Geldmittel hierfür nicht vorhanden sind (zu den Sozialversicherungsbeiträgen vgl. etwa BGH, Beschl. v. 13. Juni 2006 - IX ZB 238/05). Einer ausdrücklichen Zahlungsverweigerung bedarf es nicht (BGH, Urt. v. 22. November 1990 - IX ZR 103/90).
- Anfechtungsvoraussetzung ist gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO, dass die Beklagte die Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin kannte. Hierzu hat der Kläger vorgetragen, das Berufungsgericht aber keine Feststellungen getroffen. Für die Kenntnis genügt es, wenn die Beklagte aus den ihr bekannten Tatsachen und dem Verhalten der Schuldnerin bei natürlicher Betrachtungsweise den zutreffenden Schluss gezogen hat, dass die Schuldnerin wesentliche Teile, d.h. 10 % und mehr, ihrer fällig gestellten Verbindlichkeiten in einem Zeitraum von drei Wochen nicht wird tilgen können. Dieser Kenntnis steht nach § 130 Abs. 2 InsO die Kenntnis von Umständen gleich, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen.
BGH, Urteil vom 30.06.2011,IX ZR 134/10
Leitsatz: Der Schuldner hat die Zahlungen eingestellt, wenn er einen maßgeblichen Teil der fälligen Verbindlichkeiten nicht bezahlt. Diese Feststellung kann nicht nur durch eine Gegenüberstellung der beglichenen und der offenen Verbindlichkeiten, sondern auch mit Hilfe von Indiztatsachen getroffen werden.
Der BGH führte aus:- Nach §133 Abs. 1 Satz 1 InsO ist eine Rechtshandlung anfechtbar, welche der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Der Benachteiligungsvorsatz ist gegeben, wenn der Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung (§ 140 InsO) die Benachteiligung der Gläubiger im Allgemeinen als Erfolg seiner Rechtshandlung gewollt oder als mutmaßliche Folge - sei es auch als unvermeidliche Nebenfolge eines an sich erstrebten anderen Vorteils - erkannt und gebilligt hat. Ein Schuldner, der seine Zahlungsunfähigkeit kennt, handelt in aller Regel mit Benachteiligungsvorsatz. Dessen Vorliegen ist jedoch schon dann zu vermuten, wenn der Schuldner seine drohende Zahlungsunfähigkeit kennt. Dies ergibt sich mittelbar aus § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO. Da für den anderen Teil die Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners vermutet wird, wenn er wusste, dass dessen Zahlungsunfähigkeit drohte, können für den Vorsatz des Schuldners selbst keine strengeren Anforderungen gelten (BGH, Urteil vom 13. April 2006 - IX ZR 158/05; vom 20. Dezember 2007 - IX ZR 93/06).
- Zu Unrecht hat das Berufungsgericht auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts eine Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Abs. 1 InsO) des Schuldners verneint. Eine Gesamtwürdigung der hier zu beachtenden Indizien gestattet den Schluss von einer Zahlungseinstellung auf eine Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) des Schuldners während des gesamten Zahlungszeitraums. Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit beurteilt sich im gesamten Insolvenzrecht und darum auch im Rahmen des Insolvenzanfechtungsrechts nach § 17 InsO (BGH, Beschluss vom 13. Juni 2006 - IX ZB 238/05). Zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO kann eine Liquiditätsbilanz aufgestellt werden. Eine solche Liquiditätsbilanz ist im Anfechtungsprozess jedoch entbehrlich, wenn eine Zahlungseinstellung (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO) die gesetzliche Vermutung der Zahlungsunfähigkeit begründet (BGH, Urteil vom 20. November 2001 - IX ZR 48/01; vom 12. Oktober 2006 - IX ZR 228/03; vom 21. Juni 2007 - IX ZR 231/04).
- Im Streitfall ist infolge einer Zahlungseinstellung von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners auszugehen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO). Zahlungseinstellung ist dasjenige nach außen hervortretende Verhalten des Schuldners, in dem sich typischerweise ausdrückt, dass er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen (BGH, Urteil vom 20. November 2001 - IX ZR 48/01). Es muss sich mindestens für die beteiligten Verkehrskreise der berechtigte Eindruck aufdrängen, dass der Schuldner außerstande ist, seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen zu genügen (BGH, Urteil vom 21. Juni 2007 - IX ZR 231/04). Die tatsächliche Nichtzahlung eines erheblichen Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Zahlungseinstellung aus (BGH, Urteil vom 21. Juni 2007; vom 20. Dezember 2007 - IX ZR 93/06). Das gilt selbst dann, wenn tatsächlich noch geleistete Zahlungen beträchtlich sind, aber im Verhältnis zu den fälligen Gesamtschulden nicht den wesentlichen Teil ausmachen (BGH, Urteil vom 21. Juni 2007; Urteil vom 11. Februar 2010 - IX ZR 104/07). Die Nichtzahlung einer einzigen Verbindlichkeit kann eine Zahlungseinstellung begründen, wenn die Forderung von insgesamt nicht unbeträchtlicher Höhe ist (BGH, Urteil vom 20. November 2001- IX ZR 48/01).
- Haben im fraglichen Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten bestanden, die bis zur Verfahrenseröffnung nicht mehr beglichen worden sind, ist regelmäßig von Zahlungseinstellung auszugehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Oktober 2006 - IX ZR 228/03). Eine bloß vorübergehende Zahlungsstockung liegt nicht vor, wenn es dem Schuldner über mehrere Monate nicht gelingt, seine fälligen Verbindlichkeiten spätestens innerhalb von drei Wochen auszugleichen und die rückständigen Beträge insgesamt so erheblich sind, dass von lediglich geringfügigen Liquiditätslücken keine Rede sein kann (BGH, Urteil vom 11. Februar 2010 - IX ZR 104/07). Eine Zahlungseinstellung kann aus einem einzelnen, aber auch aus einer Gesamtschau mehrerer darauf hindeutender, in der Rechtsprechung entwickelter Beweisanzeichen gefolgert werden (BGH, Beschluss vom 13. April 2006 - IX ZB 118/04; vgl. Urteil vom 13. Juni 2006 - IX ZB 238/05). Sind derartige Indizien vorhanden, bedarf es nicht einer darüber hinaus gehenden Darlegung und Feststellung der genauen Höhe der gegen den Schuldner bestehenden Verbindlichkeiten oder gar einer Unterdeckung von mindestens 10 v.H. (BGH, Beschluss vom 13. Juni 2006 - IX ZB 238/05). Dafür kann auch ein Vortrag ausreichend sein, der zwar in bestimmten Punkten lückenhaft ist, eine Ergänzung fehlender Tatsachen aber schon auf der Grundlage von Beweisanzeichen zulässt (vgl. BGH, Urteil vom 8. Oktober 1998 - IX ZR 337/97). Es obliegt dann dem Tatrichter, ausgehend von den festgestellten Indizien eine Gesamtabwägung vorzunehmen, ob eine Zahlungseinstellung gegeben ist (BGH, Urteil vom 11. Juli 1991 - IX ZR 230/90).
- Überblick
- Historie
- Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit
- Angst vor der Insolvenz
- Insolvenz und Vermögen
- Erhaltung von Tradition und Einfluss
- Umwandlung FK in EK
- Sanierungsgewinn
- Mantelkauf
- Beispiel Sanierungsinvestition
- Zahlungsunfähigkeit
- Überschuldung
- InsO
- Insolvenzplan
- Schutzschirmverfahren
- Sanierungskonzept und Anfechtungsrisiko
- Schlüssiges Sanierungskonzept
- Organisation der Sanierung
- BQG
- Forderungsanmeldung
- Geschäftsführerhaftung
Unternehmens-
sanierung
aktuelle eBooks zum Thema:
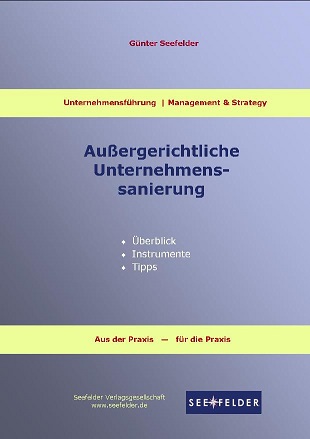 Außergerichtliche Sanierung von Unternehmen
Außergerichtliche Sanierung von UnternehmenAuflage: 2018, 99 Seiten DIN A 4
Einführung, Instrumente, Tipps
24.97 €
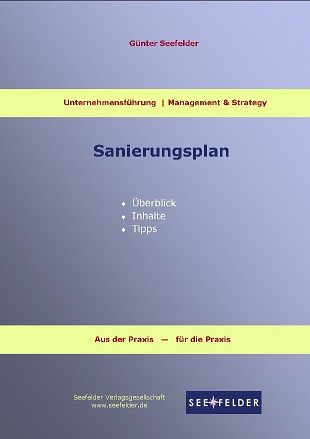 Sanierungsplan
SanierungsplanAuflage: 2019, 76 Seiten DIN A 4
Einführung, Tipps, Checklisten
24.97 €
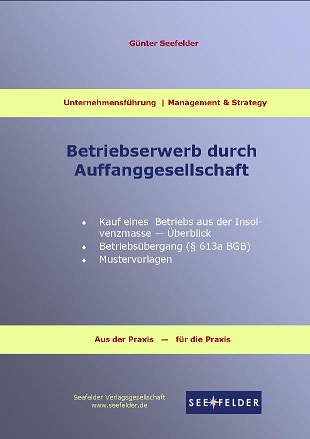 Betriebserwerb durch Auffanggesellschaft
Betriebserwerb durch AuffanggesellschaftAuflage: 2015, 33 Seiten DIN A 4
Erläuterung, Tipps, Vertragsmuster
18.97 €
Interpretation von Sprüchen für die Unternehmensführung:
Der Ausgangspunkt für die großartigen Unternehmen liegt oft in kaum wahrnehmbaren Gelegenheiten.
Demosthenes